News-Archiv
Das Gemeinsame in die Mitte rücken
Reformationsjubiläum 2017 ökumenisch feiern?
18.1.2016
In Deutschland wird in 2017 das Reformationsjubiläum gefeiert. Vor 500 Jahren hat der Thesenanschlag Martin Luthers im Jahre 1517 die Welt und die Kirche verändert. Luther wollte die katholische Kirche reformieren. Es entstand die evangelische Kirche. Beide Kirchen gingen getrennte Wege, teils mit heftigen Auseinandersetzungen in Folge der Trennung.
Was soll nun 2017 gefeiert werden? Die Trennung? Die reformatorischen Entdeckungen Luthers? Oder ist das aufeinander Zugehen der beiden Kirchen in den vergangenen Jahrzehnten so weit gediehen, dass etliche Veranstaltungen im Rahmen des Reformationsjubiläums gemeinsam, also ökumenisch ausgerichtet werden können?
Um dieser Frage nachzugehen, hatten die Ev. Kirchengemeinde und der katholische Pastoralverbund Olpe am vergangenen Mittwoch (13. Januar 2016) im Rahmen der ökumenischen Woche zu einer Podiumsdiskussion in ihr Gemeindezentrum in Olpe eingeladen. In einer Region, in der die evangelische Kirche deutlich in der Minderheit ist, ist das ökumenische Miteinander schon weit gediehen, verrät der evangelische Gemeindepfarrer Wolfgang Schaefer. Dreimal im Jahr treffen sich die Hauptamtlichen zu gemeinsamen Dienstbesprechungen. Die Idee zu dieser Podiumsdiskussion kam von katholischer Seite. Das gute Miteinander wird durch den katholischen Pfarrer Clemens Steiling bestätigt. Beide Pfarrer leiten gemeinsam den Diskussionsabend. An katholischen Hochfesten beispielsweise, so Steiling schmunzelnd, werde eine ökumenische Vesper gefeiert. Der evangelische Pfarrer halte die Predigt und er sorge für den notwendigen Weihrauch. Steiling: „Bei den Treffen der Pfarrer wissen wir nicht, worüber wir uns streiten sollen.“
Unterschiedliche Sichtweisen
Dass es doch unterschiedliche Sichtweisen gibt, zeigte das Podiumsgespräch mit hochkarätigen Diskutanten. Die evangelische Position vertrat Oberkirchenrat Dr. Ulrich Möller. Möller gehört zur Leitung der Evangelischen Kirche von Westfalen und ist zuständig für die Themen Weltmission, Ökumene und kirchliche Weltverantwortung. Die katholische Sichtweise zeigte Dr. Michael Hardt auf. Hardt ist Direktor des Möhler-Institutes für Ökumenik in Paderborn und Leiter der Fachstelle Ökumene im Erzbischöflischen Generalvikariat Paderborn.
Möller begann mit einem Impulsreferat und betonte, dass die Konfessionen in den vergangenen Jahrzehnten sehr aufeinander zugegangen seien. Möller: „Was verbindet, ist stärker als das, was trennt.“ 2017 sollten die Perlen der eigenen Tradition zum Glänzen gebracht und der gemeinsame Auftrag betont werden. Das Jubiläumsjahr biete viele Gelegenheiten, die Beziehungen zwischen den beiden Kirchen zu bekräftigen und zu vertiefen sowie Verwerfungen und Missverständnisse aufzuarbeiten. 2017 könne zum Anlass genommen werden, die Zukunft stärker gemeinsam zu gestalten. Den Kirchengemeinden empfahl der Oberkirchenrat, das ökumenische Miteinander zu thematisieren. Beide Kirchen müssten miteinander das Gemeinsame und wirklich Trennende herausarbeiten. Dabei dürften Unterschiede nicht verniedlicht werden. Möller: „Aber angesichts der Entkirchlichung der Gesellschaft gibt es keine Alternative zum gemeinsamen Zeugnis in der Welt.“ Er erinnerte an die Vorgeschichte der Reformation, benannte Calvin, Zwingli und die Waldenser. Die reformatorischen Impulse seien kein deutsch-protestantischer Besitz, sondern hätten eine europäische Dimension. Er betonte, dass die evangelische Kirche nicht erst vor 500 Jahren entstanden sei, sondern mit der Auferstehung Jesu Christi und dem Ausgießen des Heiligen Geistes ihren Anfang genommen habe. Eine erste Trennung erfolgte bereits rd. 500 Jahre vor der Reformation zwischen der West- und Ostkirche. Luthers Ansinnen sei nicht die Trennung der Kirche gewesen, sondern deren Reformation. Möller betonte: „Wir feiern nicht uns selbst, sondern Christus als Mitte und Grund unseres Glaubens. Die Feier muss auf Jesus Christus selbst zielen. Ihre Identität hat die Kirche nicht in sich selbst, sondern in Christus. Das Heil wird im Glauben empfangen.“ Daher sei das Reformationsfest als Christusfest zu feiern. Möller verwies auf eine Erklärung des ökumenischen Rates der Kirchen 2013 in Busan, wonach die Wiederherstellung der Einheit der Kirchen unter der Leitung des Heiligen Geistes wegen des gemeinsamen Auftrages als dringend geboten angesehen werde.
Hardt machte in seinem Impulsreferat deutlich, dass die geistliche Ökumene der Motor der Ökumene sei. Hardt: „Wir leben in einem ökumenischen Zeitalter.“ 1948 sei der Ökumenische Rat der Kirchen (ÖKR) gegründet worden. Nach dem 2. Vatikanischen Konzil sei eine Verbindung zwischen der Katholischen Kirche und dem ÖKR entstanden. Seit den 70er Jahren gäbe es die Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen, in der auch Freikirchen mitarbeiteten. Er erinnerte daran, dass vor 40 Jahren die Leuenberger Konkordie die Abendmahl- und Kanzelgemeinschaft der Evangelischen untereinander gebracht habe. Hinter dem allen liege eine Leidensgeschichte, die die Evangelischen, auch untereinander, aber auch die katholische Kirche und die orthodoxe Kirche gemeinsam hätten. Die Vergangenheit könne zwar nicht verändert werden, aber die Präsenz der Vergangenheit in der Gegenwart lasse sich verändern. Er sieht die Reformation des 16. Jahrhunderts als einen Prozess bis heute. Das Trienter Konzil habe auf die Reformation geantwortet. Hier sei versucht worden, Luther zu verstehen. Die Erneuerer als auch deren Gegner hätten sich auf die Bibel berufen. Es gebe keinen Blick von außen auf die Reformation. Den Anderen verstehen zu wollen, führe auch zum Verständnis der eigenen Position.
Hardt stellte kritisch die Frage, was am 31. Oktober 2017 eigentlich gefeiert werden solle? Die Dekade habe anfangs Lutherdekade geheißen. Daraus sei inzwischen unter der Hand die Reformationsdekade geworden. Gehe es um den Ablassstreit, die Auseinandersetzung mit den Gegnern Luthers oder mit dem Papst? Es sei zwischenzeitlich die Rede von der „Kirche der Freiheit“ aufgetaucht. Ökumenische Christen fragten, ob sie die Kirche der Unfreiheit seien? Auch Hardt betonte, dass die Reformation die Erneuerung der abendländischen Christenheit und nicht die Kirchenspaltung gewollt habe. Auf Letztere habe womöglich auch die politische Entwicklung Einfluss gehabt. Das Motto „Christusjahr“ rücke das Gemeinsame in die Mitte.
Hardt: „Wir können die Ökumene nicht auf dem Vergessen der Tradition gründen. Jeder liest die Heilige Schrift in seinem historischen Kontext.“ Er spricht sich auch dafür aus, aufzuarbeiten, was trenne und zu sehen, ob es Kirchen trennend sei oder zum jeweiligen Kolorit der Kirche gehöre.
Hardt regte an, in künftigen gemeinsamen Gesprächen immer von der Perspektive der Einheit auszugehen und sich vom Zeugnis des Glaubens verändern zu lassen. Es sollte erneut die sichtbare Einheit gesucht und entsprechende Schritte gegangen werden. Er habe den Eindruck, dass die Sehnsucht nach der einen sichtbaren Kirche nicht mehr da sei. Es bestünden unterschiedliche Modelle und keine Vorstellung, wie die sichtbare Einheit aussehen solle. Es müsse dabei auch eine Gemeinschaft mit dem Papst in Rom geben. Die sichtbare Einheit der Kraft des Evangeliums müsse für unsere Zeit wiederentdeckt werden und es gelte, Zeugnis in der Welt von Gottes Gnade abzulegen.
Gesprächsrunde
In einer Gesprächsrunde wird das unterschiedliche Lehramtsverständnis angesprochen. Beide Kirchen berufen sich auf die Bibel, die aber unterschiedlich gedeutet wird. Für die katholische Kirche ist die Tradition, also die historische Interpretation der Schrift, maßgeblich. Das Lehramt diene der Schrift, so Hardt. Möller verweist auf eine Schrift des frühen Luther mit dem sperrigen Titel „Daß ein christliche Versammlung oder Gemeine Recht und die Macht habe, alle Lehre zu urtheilen und Lehrer zu berufen, ein- und abzusetzen, Grund und Ursach aus der Schrift“. Hiernach habe die hörende Gemeinde zu beurteilen, ob dem Lehramt vertraut werden könne. Dies führe in der evangelischen Kirche zu einem diskursiven Prozess.
Auf die Frage, wie man die Ökumene in 100 Jahren sehe, wünschte sich Hardt, dass evangelische Christen an der Eucharistie und katholische Christen am Abendmahl teilnehmen. Zudem fände er es gut, wenn evangelische, katholische und orthodoxe Christen in einem großen Netz der Eucharistiegemeinschaft verbunden seien, und dass es gemeinsame Synoden und Konzile gäbe, um strittige Fragen zu klären.
Möller hofft, dass in 20 Jahren die Kirchen in ihrer Vielfalt einen Reichtum des christlichen Glaubens darstellten, dass andere Menschen zum Staunen kämen, wie die Christen in der Kraft der Hoffnung, der Zuversicht und Liebe lebten.
An der katholischen Kirche schätzt Möller, dass sie Kirche der ganzen Welt sei, eine Einheit der Verbundenheit. Die Erkennbarkeit der Einheit sei ein großer Reichtum. In der katholischen Kirche sei ein Gottesdienst auch gut, wenn die Predigt schlecht gewesen sei. Hier spiele die leibliche Erfahrung von Gottesdienst eine große Rolle. Manche Evangelische glaubten, die Predigt sei alles, und wenn die schlecht sei, sei alles nichts.
Hardt schätzt in der evangelischen Kirche die größere Bereitschaft, Spannungen auszuhalten. Hinzu komme die Synodalität, die Zusammenarbeit von Amtsträgern und Laien.
Der musikalische Rahmen der Podiumsdiskussion wurde vom „Gospelchor Upstair Olpe“ unter der Leitung von Christof Mann gestaltet.
kp
Text zum Bild: (Fotos Karlfried Petri)
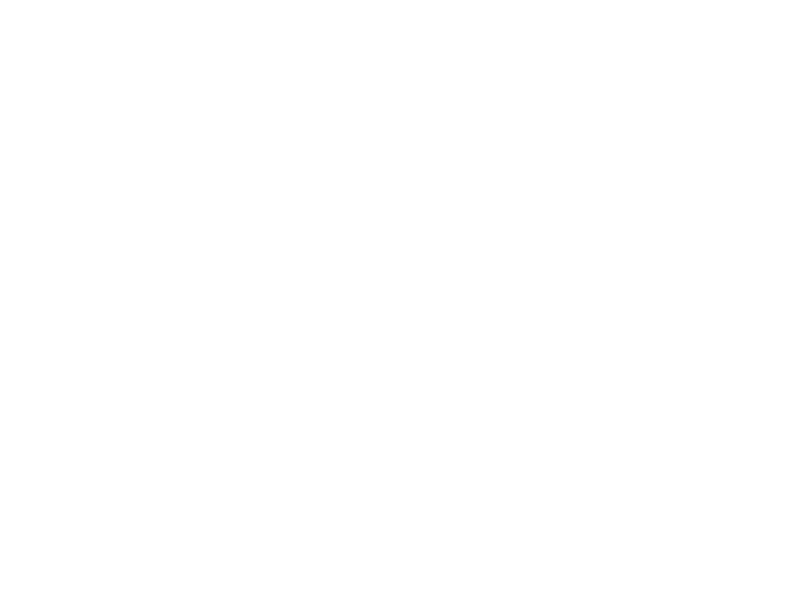
Oberkirchenrat Dr. Ulrich Möller: „Was verbindet ist stärker als das was trennt.“
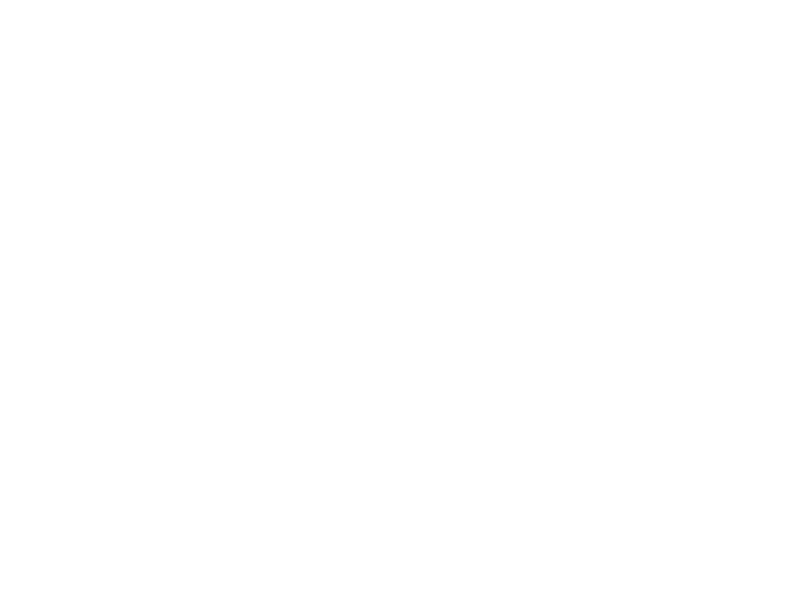
Direktor Dr. Michael Hardt: „Wir leben in einem ökumenischen Zeitalter.“
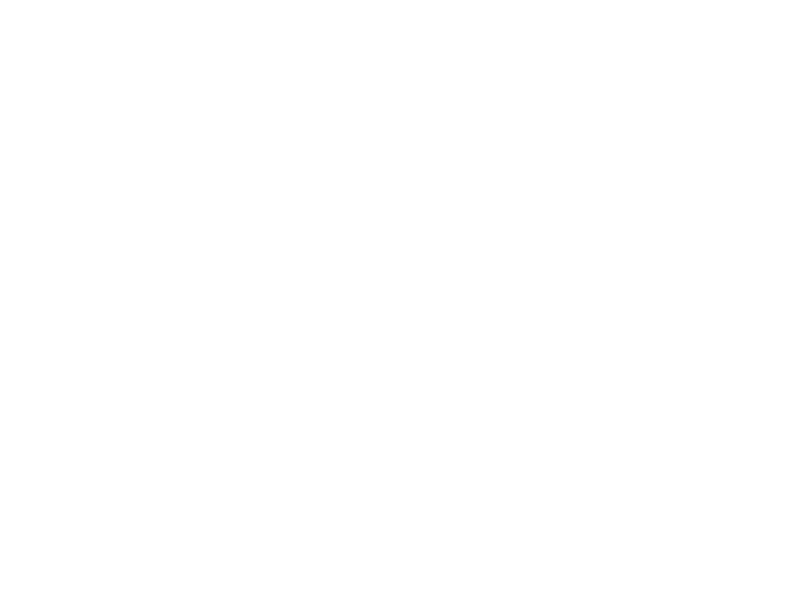
Der „Gospelchor Upstairs Olpe“ hatte das passende Liedgut für die Veranstaltung ausgewählt.
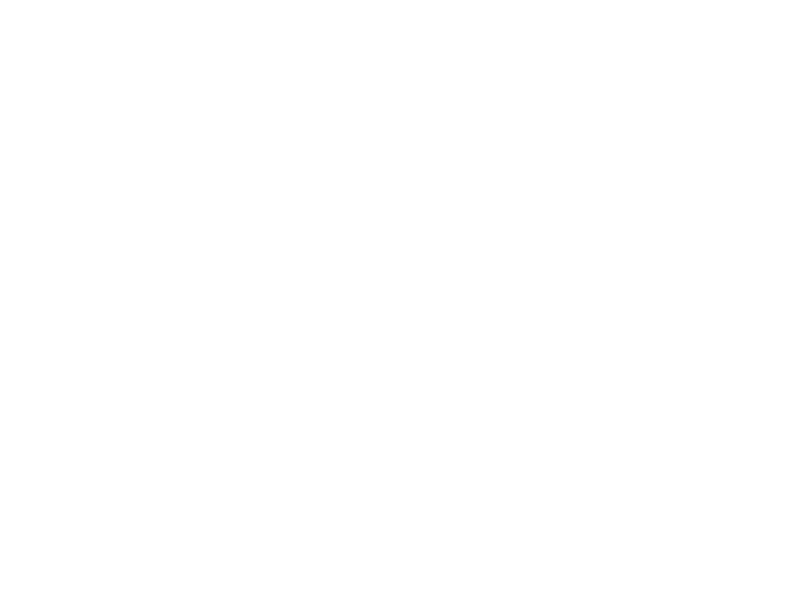
Die Pfarrer Wolfgang Schaefer und Clemens Steiling (v. li.) moderieren die Podiumsdiskussion.

