News-Archiv
Siegener Pfarrkonferenz fragt:
Wieviel Kirche steckt in der Diakonie?
19.2.2019
Mehrmals im Jahr treffen sich unsere Pfarrerinnen und Pfarrer im Evangelischen Kirchenkreis Siegen in der sogenannten Pfarrkonferenz, um über Teilbereiche ihrer Arbeit zu reden, sich fortzubilden und Gemeinschaft zu pflegen. Kürzlich stand ein Thema auf der Tagesordnung, das die Kirche bewegt solange es Kirche gibt. Es ging um das Miteinander von Kirche und Diakonie, oder zugespitzt formuliert: Wieviel Kirche steckt in der Diakonie? Schon zur Zeit der Apostelgeschichte stellte die Gemeindeleitung in Jerusalem fest, dass die Witwen zu kurz kamen und zusätzliche Menschen sich kümmern müssten. Aus diesem Zusätzlichen wurde im Laufe der 2000 Jahre zumindest in der Evangelischen Kirche in Deutschland eine eigenständige Organisation. Kein Wunder, dass es immer zu gegenseitigen Anfragen kommt, weil man zu wenig voneinander weiß und auch ab und an unterschiedliche Standpunkte aus verschiedenen Strukturen heraus vertritt. Sind doch beide Organisationen unterschiedlichen Bedingungen ausgesetzt. Die Diakonie ist eingebunden in medizinische und soziale Professionen, wirtschaftlichen Wettbewerb, staatliche Vorgaben, betriebswirtschaftliche Notwendigkeiten und will dabei ihre christlichen Werte leben. Sie ist Arbeitgeber für 3600 Menschen.
Superintendent Peter-Thomas Stuberg bezeichnete die Diakonie als Kirche Jesu Christi an anderer Stelle und mit anderer Intention als die Kirche. Er begrüßte besonders Pfarrer Jörn Contag, seit Mai 2018 Theologischer Geschäftsführer der Diakonie in Südwestfalen und unter anderem verantwortlich für die Nahtstelle der beiden Strukturen Kirche / Diakonie und für die Gestaltung des kirchlichen Profils in der Diakonie.
Der langjährige Diakoniemitarbeiter Dirk Hermann, zuständig für die Begleitung der jährlich 100 jungen Menschen, die in den Diakonischen Einrichtungen ein freiwilliges Soziales Jahr absolvieren, reiste zunächst mit den Pfarrern durch die Geschichte der heimischen Diakonie, die vor 200 Jahren im Ferndorftal ihren Anfang nahm und heute ein modernes und leistungsstarkes Unternehmen mit Krankenhäusern, Altenheimen und weiteren Sozialdiensten ist.
Pfarrer Contag schilderte anschließend die Entwicklung der Diakonie im Allgemeinen und erwähnte die Leisniger Kastenordnung aus dem Jahre 1523, das älteste Sozialpapier der Welt. Diese Ordnung leistete einen eigenständigen Beitrag zu den sozialen und diakonischen Aspekten der Reformation. Luther ließ sie überarbeiten und verbreiten. Unter Fliedner und Wichern wurde die diakonische Arbeit in Form eigenständiger Vereine losgelöst von kirchlichen Strukturen organisiert. Es entstanden die Innere Mission und Mutterhäuser. Damit waren Spannungen im Blick auf die organisatorischen Eigenständigkeiten von Kirche und Diakonie gegeben. Später folgte der Wandel von der freien Mildtätigkeit hin zum staatlich gesetzten Sozialwesen mit individuellen Rechtsansprüchen. Contag: „Die Diakonie befindet sich heute in Strukturen des Sozialstaates, der für spezielle kirchlich-diakonische Dienstleistungen keinen finanziellen Spielraum lässt. Die Verkündigung und Seelsorge bleibt jedoch eine Herausforderung der Diakonie, die die Diakonie auch verwirklichen will.“ Die Leistungen werden für alle Anbieter rationiert und vereinheitlicht. Die sogenannte „Dritte Weg“ der kirchlichen Beschäftigungsregelungen wird im Rahmen staatlicher Bürgerrechte Infrage gestellt und die Berufsausübung der Beschäftigten richtet sich ausschließlich nach eigenständigen Kriterien der einzelnen Berufsgruppen.
Unter diesen Rahmenbedingungen entsteht die Frage nach der eigenen diakonischen Identität und danach, was die Diakonie von anderen sozialen Dienstleistern unterscheidet. Contag: „Das Motto der 50er Jahre ‚Danken und Dienen‘ funktioniert heute nicht mehr. Und die Gemeinden werden von der Öffentlichkeit gefragt: Wo habt ihr euer Armutsorientierung?“ Zur Zeit ist die Diakonie in Südwestfalen dabei, ihr christliches Profil zu reflektieren und zu bedenken. „Wie wird von Gott geredet?“ „Wie wird Nächstenliebe praktiziert?“ und „Wie ist das Unternehmen der Schöpfung verpflichtet?“ Contag zeigte die Handlungsfelder zur Entwicklung der kirchlichen Identität auf, die bereits im Entwurf erarbeitet wurden. Dazu gehört beispielsweise, dass die Räume der Einrichtungen wie Eingangsbereiche als kirchlich zugehörig erkennbar sind. Ethische Anforderungen des Arbeitsalltags werden in Seminaren reflektiert behandelt und das Leitbild der Diakonie wird neu ins Gespräch gebracht. Es soll stärker nach außen und innen vermittelt werden, wie die Diakonie gesellschaftlich-kirchliche Verantwortung übernimmt.
In einer lebhaften Diskussion wurde das christlich-diakonische Profil beleuchtet. Zunehmend schwierig zeigte sich, ein Alleinstellungsmerkmal kirchlich-diakonischer Einrichtungen zu definieren. Für Contag sind zwar Gottesdienste, biblische Reflexionen der Arbeit, Zuspruch für Mitarbeitende, Patienten und Klienten sowie Leistungen an den Grenzen des Lebens aus biblischer Perspektive nicht unbedingt Alleinstellungsmerkmale der Einrichtungen der Diakonie, weil andere Anbieter dies auch anböten, aber sie gehörten unbedingt dazu. Der Superintendent fasste die Leistungsherausforderungen abschließend mit zwei Kriterien zusammen: Bestmögliche Qualität mit christlichen Kriterien.
kp
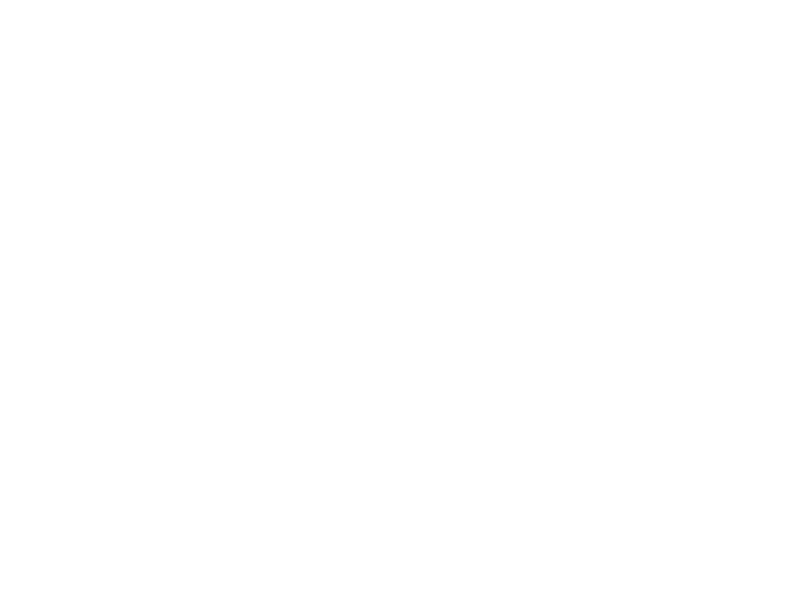
Superintendent Peter-Thomas Stuberg bedankte sich herzlich bei Pfarrer Jörn Contag (v.li) für den informativen und inspirierenden Vortag. Foto Karlfried Petri

