News-Archiv
Miteinander auskommen lernen
Gustav-Adolf-Werk engagiert sich in Syrien
8.11.2018
Das 176. Jahresfest des Gustav-Adolf-Werkes (GAW) Westfalen fand am 4. und 5. November 2018 im Evangelischen Kirchenkreis Siegen statt. Freunde und Förderer des Werkes, Gemeindeglieder, der Kreissynodalvorstand sowie eine Pfarrkonferenz kamen im Tillmann-Siebel-Haus in Freudenberg zusammen, um sich über die Arbeit des GAW Westfalen zu informieren. Dabei wurde in diesem Jahr besonders die Situation der Christen in Syrien in den Blick genommen.
Der Vorsitzende des GAW Westfalen, Pfarrer Bernd Langejürgen, Pfarrer im Berufschuldienst in Bielefeld, begrüßte die interessierten Zuhörer. Er hat den Vorsitz vor einem Jahr von Pfarrer i. R. Hans-Martin Trinnes, Freudenberg, übernommen.
Seit sieben Jahren wütet der Krieg in Syrien und hat eine der größten humanitären Katastrophen seit dem 2. Weltkrieg ausgelöst. Viele Christen sind aus Syrien geflohen vor der Gewalt der islamistischen Terrorgruppen. Das Gustav-Adolf-Werk unterstützt evangelische Gemeinden in Syrien. Es hilft, zerstörte oder beschädigte Kirchen wieder aufzubauen, getreu nach dem Motto: Menschen brauchen Dächer und Gemeinden brauchen Orte, wo sie sich treffen können, Begegnung erleben und sich wohlfühlen. Langejürgen nannte als Grundsätze des Werkes miteinander zu reden, Ausdauer, den anderen wahrzunehmen und auf Partner zu zählen. Es unterstützt humanitäre Aktivitäten evangelischer Gemeinden, wie die Verteilung von Trinkwasser oder Lebensmitteln. Und es hilft, dass evangelische Schulen geöffnet bleiben können. Diese Schulen sind für Kinder aller Religionen offen und leisten Friedensarbeit vor Ort. Das Hilfswerk hat ursprünglich Partnerkirchen in Lateinamerika sowie Süd-, West- und Osteuropa im Blick. In den letzten Jahren ist der Nahe Osten hinzugekommen.
Freudenbergs Bürgermeisterin Nicole Reschke hieß das Gustav-Adolf-Werk in Freudenberg herzlich willkommen und verwies auf die Flüchtlingsarbeit der Stadt, die von dem Netzwerk Flüchtlingshilfe tatkräftig unterstützt werde. Flüchtlinge fühlten sich in Freudenberg heute wohl und brächten sich in die Gesellschaft ein.
Lernen, eine Koexistenz zu leben
Dr. Dr. h.c. mult. Martin Tamcke, Professor für ökumenische Theologie an der Universität Göttingen, ein ausgewiesener Experte der Religions- und Kulturgeschichte des Vorderen und Mittleren Orients, begann 1975 sich für Syrien zu interessieren. Seine Forschungen werden von der Frage begleitet, wie Völker koexistieren können. Tamcke: „Ich spreche als Mensch, der ein Stück seines Herzens an die Menschen in der Region verloren hat. Um die Menschen zu verstehen braucht es die Begegnung von Mensch zu Mensch.“
Er berichtet von den Äußerungen eines 19-jährigen Teenagers in Damaskus, der auf der Internetplattform Reddit von seinem Alltag in Syrien erzählt und auf Fragen antwortet. Er schildert das Leben eines ganz normalen 19-Jährigen, der in einer Region wohnt, in der Häuser und Straßen unversehrt seien. Es gebe allerdings auch Gebiete, wo er wegen der Bomben nicht hin könne. Er halte sich aus der Politik heraus, da das Falsche zu tun oder zu sagen einen umbringen könne. Er wolle nur, dass der Krieg ende. Assad sei nicht der beste Präsident, aber er habe nichts dagegen, wenn er bleiben würde.
Eine weitere Stimme aus dem Krisengebiet gehört dem Oberhaupt der Syrischen Orthodoxen Kirche, Mor Ignatius Aphrem II. Er werde in westlichen Medien in Anspruch genommen für eine vermeintlich „unheilige“ Allianz mit Assad.
Die Syrisch Orthodoxe Kirche, so Tamcke, sei in Syrien beileibe nicht die größte, wie immer wieder in deutschen Medien behauptet werde. Aus Unkenntnis werde sie mit der orthodoxen Kirche Syriens verwechselt. Die größte Kirche in Syrien sei die Rum-Orthodoxe Kirche, zu der etwa eine Million Gläubige gehörten. Danach kämen die Armenier und dann erst käme die Syrisch Orthodoxe Kirche mit unter 300.000 Gläubigen in der Zeit vor dem Krieg. Hinzu kämen weitere orthodoxe Kirchen, katholische Ostkirchen und protestantische Kirchen.
Vor dem Krieg seien etwa 10 % der Bevölkerung Christen gewesen. Etliche von ihnen seien geflohen. Es habe vor dem Krieg kaum geschlossene Christensiedlungen gegeben. Große Aufgaben in der Zeit des Wiederaufbaus nach dem Krieg kämen den Kirchen zu. Die Fragen lauteten: Wie heilen wir die Wunden? Wie kriegen wir es hin, dass die Menschen es versuchen, in einem gemeinsamen Staat zu leben. Tamcke: „Der Mangel an Vertrauen ist dort die Last für die Zukunft.“ Es gehe nicht nur um Dächer und Gebäude, sondern um die Aufarbeitung von Vergangenheit. Dazu gehöre es, sich die Geschichten der Völker Syriens anzuhören. Dazu gehörten auch die Armenier und christlichen Ostsyrer, die sich in der Khaburregion niedergelassen haben und dort Opfer des IS wurden. Thamcke: „Als meine Studierenden in einem Flüchtlingszentrum die aus dieser Region geflohenen Jugendlichen befragten, ob sie nach dem Sieg über den IS in ihre Heimat zurückkehren würden, in die ihre Großeltern geflohen waren und in der sie doch unter friedlichen Bedingungen aufgewachsen waren, lautet deren meine Studierenden frustrierende Antwort: nein. Sie hätten den Eindruck, dass sie in dieser Gegend der Welt nicht willkommen seien. Und sie nutzten für diese Entscheidung den Hinweis auf das, was ihnen in den letzten anderthalb Jahrhunderten widerfahren sei. Sie leben heute in Australien.“ Für Tamcke ist es wichtig, dass Christen in Syrien bleiben. Nur so könne man einander besser wahrnehmen und lernen eine Koexistenz zu leben. Das lerne man nur, wenn man miteinander rede, Tee trinke, Brot kaufe oder zur Schule gehe. Daher müsse in die Orte investiert werden. Keiner, der dort lebe, sei ohne Trauma. Die Menschen müssten von ihrer Angst enthoben werden, eine Vision erhalten verbunden mit einer guten Ausbildung.
In einer Fragerunde machte Tamcke deutlich, zurzeit sehe es so aus, dass Assad die Oberhand in Syrien habe. Die Hisbollah, Russland, der Iran und Saudi-Arabien hätten Einfluss in Syrien. Die Demokratischen Gruppen seien außen vor. Daher müsse man wohl die Zukunft mit Assad gestalten. Seine Vision sei, dass die Syrer einmal dahin kämen, ihre Zukunft selbst zu bestimmen.
Hoffnungszeichen in Homs
Mofid Karajili ist seit 2012 Pfarrer der Presbyterianischen-Reformierten Kirchengemeinde in Homs, Syrien. Er berichtete über die Zerstörungen der Kirchengebäude durch die radikal-islamischen Gruppen. 60.000 hätten den Ort innerhalb einer Woche verlassen müssen. Auch das Pfarrhaus sei geräumt worden. Regierungstruppen eroberten die Stadt zurück. Bilder zeigten die zerschossene Kirche der Gemeinde. Mit Hilfe von Mitteln des Gustav-Adolf-Werkes konnten die Gebäude wieder repariert und saniert werden. Am 24. Dezember 2015 habe man in der renovierten Kirche wieder Gottesdienst feiern können. Heute betreibt die Gemeinde eine Schule mit 1300 Schülern. Die Schule genieße hohes Ansehen. Und auch ein ökumenisch betriebenes Altersheim ist in der Verantwortung der Kirchengemeinde. Sowohl die Schule als auch das Altersheim ist für Muslime offen. Karajili berichtete über „Space of hope“, eine Form der kirchlichen Jugendarbeit, wo junge Menschen unterschiedlicher Religionen lernten, gemeinsam miteinander Projekte zu gestalten.
Das Gustav-Adolf-Werk ist das älteste evangelische Hilfswerk in Deutschland und wurde 1832 in Leipzig gegründet. Der Name wurde gewählt in Erinnerung an den schwedischen König Gustav II. Adolf, der im 30-jährigen Krieg eine Niederlage der Protestanten verhinderte. Das Hilfswerk unterstützt evangelische Kirchen, die in ihren Regionen eine Minderheit sind.
kp
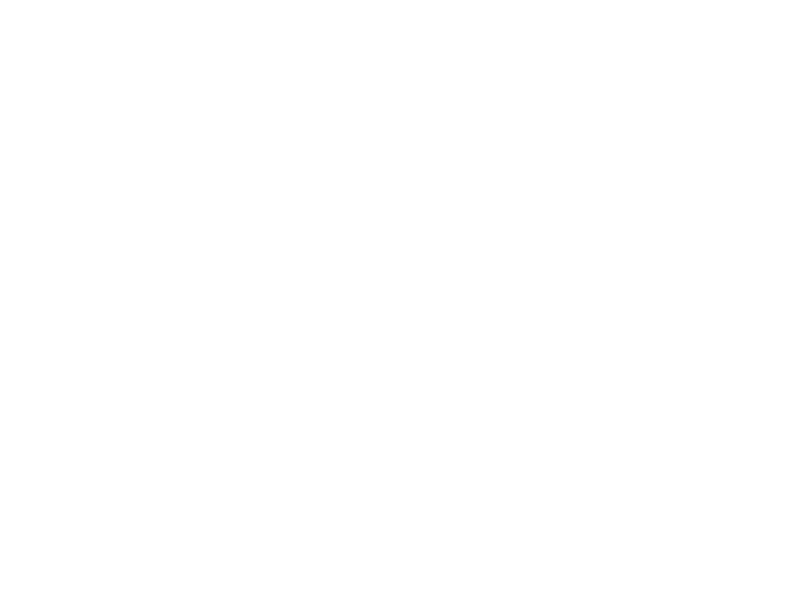
Prof.Dr. Martin Tamcke, Universität Göttingen, informierte eindrücklich über die derzeitige Situation der Christen in Syrien. Fotos: Karlfried Petri
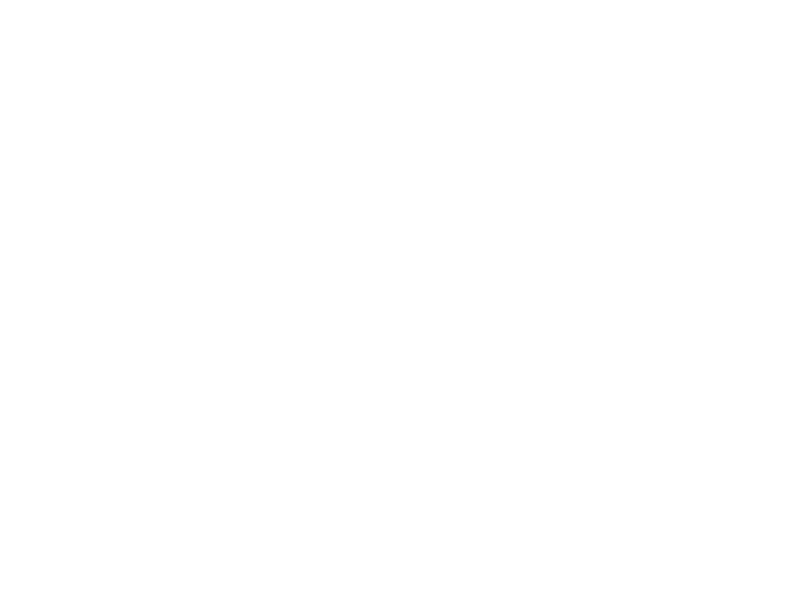
Pfarrer Mofid Karajili schilderte die hoffnungsvolle Arbeit der evangelischen Kirchengemeinde in Homs, Syrien.

